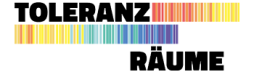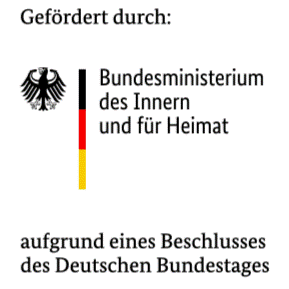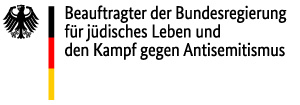Mehr zum Thema...
Was ist Toleranz?
Toleranz und Respekt sind zentrale Komponenten für das friedliche Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. Diese beiden Begriffe sind auch die inhaltlichen Anker für die Ausstellung „ToleranzRäume“. Was genau sind Toleranz und Respekt? Wie sind sie miteinander verbunden und welche Rolle spielen sie für unser Leben?
Toleranz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Ertragen, Geduld“. Mit der europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde Toleranz zu einer zentralen gesellschaftlichen Idee. Damit sollte die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, des Denkens und der Meinung garantiert werden.
Toleranz bildet in unserer Gegenwart eine Basis für das Miteinander der Vielen. Sie ermöglicht eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Überzeugungen und Lebensweisen. Mit einer toleranten Haltung können Konflikte besser reguliert werden.
Aber: Auch das Konzept von Toleranz selbst wird kontrovers diskutiert, da es unterschiedliche Vorstellungen und Ausprägungen davon gibt. Für manche bedeutet Toleranz, zum Beispiel in Verbindung mit Macht, eine Form der Unterdrückung oder eine herablassende, gleichgültige Haltung. Hier tut sich im klassischen Sinne des Wortes „Toleranz“ die Frage auf, wer befindet sich in der Position, eine andere Haltung zu tolerieren.
Der Sozialpsychologe Professor Bernd Simon definiert heute Toleranz als „durch Respekt gezähmte Ablehnung. Wenn wir andere Menschen als ‚Gleiche‘ respektieren, dann tolerieren wir sie und ihre Lebensweisen auch und gerade dann, wenn wir diese eigentlich ablehnen .“ (Simon, 2018, zitiert nach Christian-Albrechts-Universität Kiel, 2018)
Demnach fußt Toleranz auf der Anerkennung der Gleichwertigkeit eines anderen Menschen. Diese Anerkennung der Gleichwertigkeit setzt den Rahmen und die Grenzen dessen, was tolerierbar ist, damit gesellschaftliches Leben und Teilhabe gelingen können. Gleichzeit beinhaltet Toleranz eine Ablehnung von Meinungen oder Handlungen in diesem Rahmen – denn laut Simon spricht man nur dann von Toleranz, wenn es auch ein Element der Ablehnung gibt.
Für den Philosophen Rainer Forst besteht Toleranz aus folgenden drei Komponenten: Der Ablehnung, der Akzeptanz und der Zurückweisung. Die Ablehnung von Haltungen, Einstellung, Meinungen und Handlungen die als falsch oder schlecht empfunden werden. Weiter spricht Forst von der Akzeptanz im Hinblick auf Gründe, warum wir etwas tolerieren müssen sowie von Zurückweisung verschiedener Haltungen, Meinungen und Einstellungen, die über die Grenzen der Toleranz und des demokratischen Miteinanders hinausgehen (vgl. Forst 2003).
Diese Grenzen gilt es auf der Grundlage des gemeinsamen Werts der Freiheit und des Schutzes aller immer wieder neu zu verhandeln. Damit verbundene Konflikte sowie Auseinandersetzungen sind ein unabdingbarer Teil der Toleranz und erfordern diskursive Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Empathie, eine demokratische Streit- und Debattenkultur sowie die Fähigkeit, Widersprüche und Uneinigkeiten zu ertragen. Hier sprechen wir von der sog. Widerspruchstoleranz, die zuerst von Else Frenkel-Brunswik erforscht wurde, und die uns in Momenten der Unsicherheit davor bewahren soll/kann, absolute Eindeutigkeit zu erwarten bzw. einzufordern. Gleichzeitig ist es nicht egal, wem wir Toleranz und Respekt entgegenbringen. Inhumanität und Extremismus können für die offene Gesellschaft zur Bedrohung werden. Daher ist der Raum der Aushandlung in unserer Gesellschaft auf demokratische Werte begrenzt. Menschenfeindliche Positionen sind nicht Teil von Toleranz, sondern diesen gilt es, entschiedenen entgegenzutreten.
Die Ausstellung ToleranzRäume greift diese vielschichtigen Gedanken auf und betont in Anlehnung an Bernd Simon und Rainer Forst die wichtige Bedeutung von Respekt (als Anerkennung der Gleichwertigkeit) in der Ausübung von Toleranz. Als Grundlage nutzt sie – in Anlehnung an Rainer Forst – das Konzept der Respekttoleranz für das Verständnis von Toleranz.
In dieser Konzeption werden demokratische Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie Teil des Ansatzes um Toleranz und Respekt. Damit ist Toleranz nicht ein Wert an sich, sondern ein Containerbegriff für verschiedene Wertvorstellungen und die stetige Aushandlung derselben. Respekttoleranz bedeutet im Konkreten: Gleichberechtigte Personen oder Gruppen achten einander und erkennen sich wechselseitig als gleichwertig an, obwohl sie in zentralen Fragen, wie etwa zur richtigen Lebensführung, nicht einer Meinung sind. Nicht eine Autorität oder Mehrheit bestimmt, was toleriert wird und was nicht, sondern gemeinsame Institutionen (Menschenrechte, Grundgesetz, Rechtsstaat, Gewaltenteilung etc.), die auf Normen aufbauen, die allgemein akzeptiert und gerechtfertigt werden.
Damit wird Toleranz sowohl zu einer aktiven Handlung als auch einem passiven Erfahren. Ich kann somit sowohl Rezipient:in, als auch handelnde Personen der Toleranz sein.
Diese Vorstellung der Toleranz, in der viele Meinungen diskutiert und marginalisierte Gruppen einbezogen werden, ist eine Herausforderung. Hierin liegt aber auch das größte Potential für unser Zusammenleben: Nur wenn wir unser Verhalten immer wieder hinterfragen und individuelle wie kollektive Bedürfnisse und Grenzen reflektieren, können wir uns als Gesellschaft und als Individuen stetig weiterentwickeln. Dem entgegen steht der Wunsch nach einfachen Lösungen, welche autoritäre Gesellschaftsformen, Gleichgültigkeit, Ignoranz und oberflächliche Harmonisierungen einschließen. Vereinfachungen bieten jedoch keine Lösungen für die Fragen einer komplexen und diversen Gesellschaft, die mit unseren Vorstellungen einer freien Gesellschaft und der Achtung der Menschenrechte vereinbar wären.
Die Ausstellung Toleranzräume setzt kritische Impulse zum Thema „Toleranz“. Sie inspiriert dazu, sich gegen Diskriminierung im Alltag einzusetzen und regt mit konkreten Beispielen zur individuellen und gesellschaftlichen Reflexion an. Besucher:innen werden eingeladen, sich der Grenzen der eigenen Toleranz bewusst zu werden. Dieser Prozess ist nicht immer leicht, kann aber innerhalb der ToleranzRäume inklusiv, barrierearm, offen und spielerisch erkundet werden.
Quellen:
Forst, Rainer (2003): Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs; Bd. 1682: suhrkamp taschenbuch wissenschaft; Suhrkamp – Berlin
Simon, Bernd (2018), zitiert nach Christian-Albrechts-Universität Kiel (2018): Kieler Forschungsstelle Toleranz an der Kieler Universität eröffnet.
URL: https://www.uni-kiel.de/de/universitaet/detailansicht/news/kieler-forschungsstelle-toleranz-an-der-kieler-universitaet-eroeffnet/