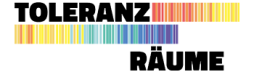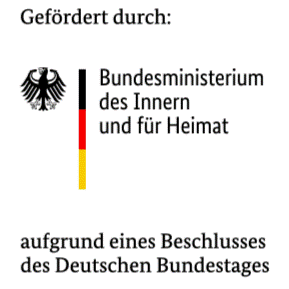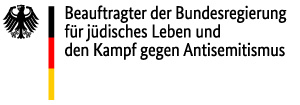Erste Hilfe
ToleranzTipps & WIssensspeicher für unterwegs!
10 Tipps, die dir in schwierigen Situationen Hilfe bieten, dich schützen, oder stärken. Außerdem findest du hier den “Wissensspeicher”, der Begriffe erklärt und einordnet. Vielleicht hast du auch einen Tipp, den du anderen mitgeben willst? Den kannst du hier hinterlassen. Denn niemand sollte wegschauen, wenn es brenzlig wird!
Tipps
Tipp 1
Ignoriere das Hassposting nicht. Du kannst einzelne Beiträge, Kommentare sowie ganze Profile oder Seiten an die Sozialen Netzwerke melden. Wenn dich eine Person belästigt, kannst du sie blockieren und Hasspostings unter deinen Beiträgen direkt löschen. Kennst du die Person persönlich, kannst du sie auch analog darauf ansprechen.
Tipp 2
Hasspostings können psychisch sehr belastend sein. Wenn du das Gefühl hast, mit der Situation überfordert zu sein, sprich mit Freund:innen darüber. Du kannst dich auch an eine Beratungsstelle wenden. Unterstützung findest du z.B. bei HateAid oder beim Bündnis gegen Cybermobbing.
https://hateaid.org/betroffenenberatung/
https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/hilfe.html
Tipp 3
Hasspostings können strafrechtliche Folgen haben. Hierfür ist es wichtig, die Angriffe mithilfe von Screenshots zu dokumentieren. Auch wenn du die Zeilen lieber schnell löschen würdest: So kann bewiesen werden, dass eine bestimmte Person eine bestimmte Aussage getroffen hat. Der VBRG und andere Beratungsstellen können hierbei helfen.
Eine Frau wird sexuell belästigt. Was kann ich tun?
Tipp 1
Sprich die Betroffene an, signalisiere ihr Unterstützung. Es ist wichtig, sich in solchen Situationen nicht alleine zu fühlen. Überlegt gemeinsam, was zu tun ist und wen ihr um Hilfe fragen möchtet, zum Beispiel am Bartresen.
Tipp 2
Möchtest du am liebsten mit einem coolen Spruch reagieren? Doch während du nachdenkst, ist die Situation vorbei? Wichtig ist, deutlich zu machen, dass auch du das Verhalten ablehnst. Du musst nicht besonders witzig sein, das ist sexistisches Verhalten auch nicht.
Tipp 3
Findet die sexistische Belästigung im Rahmen von Behörden, in der Schule oder bei der Wohnungssuche statt, können sich Betroffene an eine Antidiskriminierungsstelle wenden. Bspw. Bieten das Bündnis Gemeinsam gegen Sexismus und die Initiative Frauen gegen Gewalt e.V. hierbei Hilfe.
https://www.gemeinsam-gegen-sexismus.de/materialien/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktionen-themen/make-it-work.html
Beim Stadtfest wird eine rechte Gruppe aggressiv. Was kann ich tun?
Tipp 1
Wende dich an Beamt:innen vor Ort oder informiere die Polizei unter 110. Nenne deinen Namen, den Ort und beschreibe möglichst ruhig die Situation.
Tipp 2
Falls du nicht alleine bist oder andere Personen auf dem Fest ansprechen kannst, könnt ihr die Gruppe gemeinsam zur Rede stellen. Oftmals sind die Täter:innen bekannt. Macht ruhig, aber bestimmt deutlich, dass ihr das Verhalten nicht toleriert. Wichtig: Gefährdet euch nicht selbst.
Tipp 3
Wenn möglich, dokumentiere die Situation, scheibe auf jeden Fall ein Gedächtnisprotokoll. Die Aufzeichnungen kannst du an eine Opferberatung oder Monitoringstelle geben. Wenn es vor Ort ein „Bündnis gegen Rechts“ gibt, überlegt anschließend gemeinsam, wie ihr mit der Situation umgehen wollt.
Im Bus wird jemand angegriffen. Was kann ich tun?
Tipp 1
Wende dich an die:den Busfahrer:in und fordere sie:ihn auf, die Polizei anzurufen und an-zuhalten. Alternativ kannst du auch direkt 110 wählen. Beschreibe möglichst klar die Situa-tion und den genauen Ort des Angriffs.
In der Broschüre „Was tun nach einem rechten Angriff“ findest du viele weitere Informationen: https://verband-brg.de/vbrg-ratgeber-fuer-betroffene/
Tipp 2
Wende dich an Mitreisende und stelle dich – wenn möglich – zwischen die angegriffene Person und die Angreifer:innen. Gemeinsam könnt ihr einen Ring um die betroffene Per-son bilden. Fordere die Täter:innen ruhig aber bestimmt auf, den:die Betroffene:n in Ruhe zu lassen. Wenn möglich, dokumentiere die Situation mit deinem Smartphone.
Tipp 3
Biete der:dem Angegriffenen deine Unterstützung an: Warte mit ihm:ihr, bis die Polizei oder Rettungsdienste vor Ort sind und stelle dich als Zeug:in zur Verfügung. Frage die:den Angegriffenen, was sie sich jetzt wünscht, und stelle sicher, dass sie nicht alleine bleibt. In-formiere sie:ihn über die Unterstützung durch Opferberatungsstellen und kontaktiere die Beratungsstelle. Nicht vergessen: Schreibe ein Gedächtnisprotokoll des Vorfalls.
In meinem Umfeld radikalisiert sich jemand. Was kann ich tun?
Tipp 1
Wenn jemand andere als „Ungläubige“ abwertet oder versucht, ihnen die eigene Religion aufzuzwingen, können das Zeichen für eine religiös begründete Radikalisierung sein. Wichtig ist, in Ruhe zu klären, ob es wirklich um (z.B. islamistische) Radikalisierung oder nur Hinwendung zu einer Religion geht. Die Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus hilft, dabei Unterstützung zu finden.
Tipp 2
Kinder wollen sich ihre eigene Meinung bilden und gehört werden. Wenn sie sich dabei mit rechtsextremen Inhalten identifizieren, kann das für Eltern sehr belastend sein. Wichtig ist es, den offenen Dialog auf Augenhöhe zu suchen, Interesse zu zeigen, aber auch Grenzen gegenüber intoleranten Äußerungen zu verdeutlichen.
Ein Kind wird in der Schule ausgegrenzt. Was kann ich tun?
Tipp 1
Unterstütze die ausgegrenzte Person: Frage sie, wie du helfen kannst. Manchmal ist zuhören und da sein schon genug.
Tipp 2
Finde Verbündete in der Gruppe und sprecht euch gemeinsam gegen die Ausgrenzung aus. Gemeinsam seid ihr stärker!
Ein Mensch mit einer sog. geistigen Behinderung wird ausgelacht, angepöbelt oder missachtet. Was kann ich tun?
Tipp 1
Wenn Ihnen diese Situation passiert, versuchen Sie sich Hilfe zu holen und sich zu trauen, andere Menschen, die die Situation gesehen haben, direkt anzusprechen, um zu helfen.
Tipp 2
Wenn Sie die Situation im Rahmen von Behörden, in der Schule, bei der Wohnungssuche oder bei der Arbeit erleben, können Sie sich an eine Antidiskriminierungsstelle oder an ein*n Behindertenbeauftragte:n wenden. Die gibt es für alle Bundesländer, auch bei vielen Beratungsstellen.
Tipp 3
Wenn Sie eine solche Situation beobachten, sprechen Sie den Menschen mit Behinderung an, signalisieren Sie ihre Unterstützung. Es ist wichtig, sich in solchen Situationen nicht allein zu fühlen. Überlegen Sie gemeinsam, was zu tun ist und wen ihr um Hilfe fragen möchtet.
Am Küchentisch fallen intolerante Parolen. Wie kann ich reagieren?
Tipp 1
Mache deine Meinung zu der Äußerung ruhig aber bestimmt deutlich. Signalisiere den Beteiligten am Tisch: „Ich bin nicht einverstanden“. Aber: Wenn du nicht willst, musst du nicht diskutieren.
Tipp 2
Überlege, ob du inhaltlich in eine Diskussion einsteigen möchtest. Manchmal ist das überfordernd. Gleichzeitig ist nicht jede Äußerung am Tisch mit Bedacht gewählt. Du kannst die Person durch Nachfragen herausfordern, selbst über die Konsequenzen ihrer Aussagen nachzudenken.
Tipp 3
Falls eine weitere Person sich gegen Intoleranz ausspricht, unterstütze sie. Es ist gut, sich gegenseitig zu bestärken. In einer gemeinsamen Diskussion ist es einfacher, die Beweggründe für intolerante Positionen herauszufinden und deren Argumentationslinien zu entkräften.
Meine Kolleg:in äußert sich immer wieder queerfeindlich. Was kann ich tun?
Tipp 1
Dokumentiere die Äußerungen und lasse sie nicht unkommentiert stehen. Versuche dabei ruhig und klar gegenüber der:dem Kolleg:in zu thematisieren, warum die Äußerungen verletzend sind. Suche dir auch Unterstützung bei Kolleg:innen und Vorgesetzten. Lokale LGBTQIA+ Verbände können dich in deiner Argumentation beraten.
Tipp 2
Bei wiederkehrenden Vorfällen suche dir Unterstützung bei Betriebsräten, Supervisor:innen und/oder Gleichstellungsbeauftragen deiner Arbeitsstelle. Weitere professionelle Hilfe findest du auch bei städtischen Gleichstellungs- oder Antidiskriminierungsbeauftragten, bei örtlichen Antidiskriminierungsstellen und LGBTIQA+ Beratungen.
Tipp 3
Vielleicht ist es sinnvoll und möglich, mit Hilfe deiner Vorgesetzten und Kolleg:innen eine Fortbildung zu Themen von Antidiskriminierung und Diversität zu organisieren. Auch hier können dich lokale Beratungsstellen und Organisationen auf Angebote verweisen.
Wissensspeicher
Antifeminismus richtet sich gegen feministische Anliegen wie die Umsetzung von Gleichberechtigung oder die Stärkung weiblicher Selbstbestimmung.
Antifeminist:innen richten sich pauschal, aktiv und oft organisiert gegen Feminismus als politische und gesellschaftliche Bewegung – das geschieht vereinzelt in Internet-Diskussionen, aber auch organisiert in Parteien oder anderen Gruppierungen. Dabei ist Antifeminismus so alt wie der Kampf um Gleichberechtigung. So versuchten vor mehr als 100 Jahren Antifeminist:innen das Wahlrecht für Frauen zu torpedieren. Auch heute geht es ihnen im Kern darum, Frauen eine Rolle in der Gesellschaft zuzuweisen: Sie sollen sich um die Familie kümmern, die als „Keimzelle der Nation” betrachtet wird. Aktuell zeigt sich Antifeminismus auch als Anti-Gender-Mobilisierung. Diese richtet sich auch gegen die Vielfalt sexueller Lebensweisen und Identitäten.
Wenn eigene Vorstellungen, Wünsche und Ängste auf Juden:Jüdinnen projiziert werden und ihnen die Schuld an weltpolitischen Konflikten zugeschrieben wird, reden wir von Antisemitismus. Er kann sich in verbalen und körperlichen Angriffen gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen oder Einrichtungen richten.
Antisemitische Zuschreibungen und Gewalttaten lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Als »Antisemitismus« werden sie jedoch erst seit dem späten 19. Jahrhundert bezeichnet.
Antisemitismus wird oft mit »Judenhass« übersetzt. Er kann aber auch Erscheinungsformen annehmen, die sich weniger deutlich äußern als in offenem Hass. Trotz seiner großen Wandelbarkeit bezieht sich Antisemitismus auf wiederkehrende Bilder und Mythen: Juden:Jüdinnen werden zum universellen Sündenbock für komplexe gesellschaftliche Ereignisse und Krisen gemacht.
Literatur:
Amadeu Antonio Stiftung (2022): Antisemitismus einfach erklärt. Einfache Antworten auf grundlegende Fragen, Berlin, online unter: »https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/antisemitismus-einfach-erklaert/«.
Anne Frank Zentrum e.V.: Antisemitismus – Geschichte und Aktualität, Handreichung für pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen, online unter: »https://www.annefrank.de/bildungsarbeit/lernmaterialien/lernmaterialien-paedagogische-fachkraefte/handreichung-antisemitismus-geschichte-und-aktualitaet«.
International Holocaust Remembrance Alliance (2016): Arbeitsdefinition von Antisemitismus, online unter: »https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus«.
Coffey, Judith/ Laumann, Vivien (2021): Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen, Berlin: Verbrecher Verlag.
Neuberger, Julia (2020): Antisemitismus. Wo er herkommt, was er ist – und was nicht, Berlin: Berenberg Verlag.
Schwarz-Friesel, Monika (2019): Judenhass im Internet. Antisemitismus als kulturelle Konstante und kulturelles Gefühl, Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Israelbezogener Antisemitismus ist eine Form von Antisemitismus, bei der der Staat Israel und seine Einwohner:innen mit judenfeindlichen Bildern und Mythen besetzt werden. Er führt weltweit zu Gewalt gegen Juden:Jüdinnen, Israelis, jüdische Einrichtungen und Personen, die für jüdisch gehalten werden.
Nicht jede Kritik an der israelischen Regierung ist per se antisemitisch. Sie ist es, wenn der Staat Israel dämonisiert und ihm das Existenzrecht abgesprochen wird oder Vernichtungswünsche gegenüber ihm oder seinen Bewohner:innen geäußert werden. Auch, wenn Juden:Jüdinnen mit Israelis gleichgesetzt oder für das Handeln der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden. Um zwischen Kritik und Antisemitismus zu differenzieren, helfen die Kriterien der “3D-Regel”: wird Israel dämonisiert, delegitimiert oder dessen Politik nach doppelten Standards bewertet, liegt Israelbezogener Antisemitismus vor.
Literatur:
Amadeu Antonio Stiftung (2022): Antisemitismus einfach erklärt. Einfache Antworten auf grundlegende Fragen, Berlin, online unter: »https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/antisemitismus-einfach-erklaert/«.
Amadeu-Antonio-Stiftung (2022): Was ist israelbezogener Antisemitismus, Faltflyer, online unter: »https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/faltblatt-was-ist-israelbezogener-antisemititsmus/«.
Anne Frank Zentrum e.V.: Antisemitismus – Geschichte und Aktualität, Handreichung für pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen, online unter: »https://www.annefrank.de/bildungsarbeit/lernmaterialien/lernmaterialien-paedagogische-fachkraefte/handreichung-antisemitismus-geschichte-und-aktualitaet«.
Bernstein, Julia (2021): Israelbezogener Antisemitismus. Erkennen – Handeln – Vorbeugen. Weinheim: BeltzJuventa.
Salzborn, Samuel (2019): Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne, Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
Klein, Felix (2023): 3d-Regel Artikel, online unter: »https://www.antisemitismusbeauftragter.de/Webs/BAS/DE/bekaempfung-antisemitismus/was-ist-antisemitismus/3d-regel/3d-regel-node.html« .
Sekundärer Antisemitismus bezeichnet eine Abwehrreaktion gegen die Erinnerung an den Holocaust. Stattdessen wird der Holocaust geleugnet oder verharmlost, der deutschen Gesellschaft die Schuld abgesprochen oder Juden:Jüdinnen eine
(Mit-)Schuld an ihrer Ermordung unterstellt.
Sekundärer Antisemitismus entstand mit der Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsende bedeutete nicht, dass der Antisemitismus aus der deutschen Gesellschaft verschwand. Sekundärer Antisemitismus war eine Möglichkeit, dieser Einstellung eine neue Ausdrucksform zu geben. Durch Leugnen oder Herunterspielen des Holocaust können eigene Schuldgefühle abgeschwächt und zugleich antisemitische Gefühle ausgelebt werden. Sekundär meint nicht, dass diese Form unwichtig oder weniger gefährlich ist, sondern, dass er nachträglich (nach der Schoah) entstanden ist. Er wird deswegen auch Post-Schoah-Antisemitismus genannt.
Literatur:
Amadeu Antonio Stiftung (2022): Antisemitismus einfach erklärt. Einfache Antworten auf grundlegende Fragen, Berlin, online unter: »https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/antisemitismus-einfach-erklaert/«.
Amadeu Antonio Stiftung (Hg.) (2020): Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus in Deutschland, online unter: »https://www.vielfalt-mediathek.de/material/antisemitismus/zivilgesellschaftliches-lagebild-antisemitismus-deutschland«.
Anne Frank Zentrum e.V.: Antisemitismus – Geschichte und Aktualität, Handreichung für pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen, online unter: »https://www.annefrank.de/bildungsarbeit/lernmaterialien/lernmaterialien-paedagogische-fachkraefte/handreichung-antisemitismus-geschichte-und-aktualitaet«.
Benz, Wolfgang (2015): Antisemitismus: Präsenz und Tradition eines Ressentiments. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Benz, Wolfgang (2004): Was ist Antisemitismus?, München: Beck.
Gessler, Philipp (2006): Sekundärer Antisemitismus. Argumentationsmuster im Rechtsextremistischen Antisemitismus. In: Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier Antisemitismus, online unter: »https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/37962/sekundaerer-antisemitismus?p=0«.
Hötteman, Michael (2020): Sekundärer Antisemitismus. Antisemitismus nach Auschwitz. In: Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier Antisemitismus, online unter: »https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/321575/sekundaerer-antisemitismus«.
Anti-Asiatischer Rassismus richtet sich gegen Asiat:innen und asiatisch gelesene Personen, die aufgrund von äußerlichen und kulturellen Merkmalen diskriminiert werden.
Das geht zum Teil mit widersprüchlichen Stereotypen einher. Einerseits besteht ein kolonial geprägtes Bild von fremden, minderwertigen und gefährlichen Asiat:innen. Besonders Frauen werden aufgrund historischer Exotisierung diskriminiert.
Als „Model Minority“ werden Asiat:innen dagegen als besonders positiv integrierte Gruppe im Vergleich zu anderen Minderheiten hervorgehoben, meist ohne Differenzierung ihrer Person, Kultur und Nationalität.
Anti-Asiatischen Rassismus gibt es schon lange in Deutschland. Durch die Covid-19-Pandemie hat er sich verstärkt. Viele Betroffene berichteten von unterlassener medizinischer Versorgung, Zutrittsverboten, Bedrohungen am Arbeitsplatz sowie institutioneller Diskriminierung (Racial Profiling) und rassistischer Medienberichterstattung.
Diese Form von Rassismus richtet sich gegen Schwarze Afrikaner:innen, Menschen der afrikanischen Diaspora und als Schwarz gelesene Personen.
Anti-Schwarzer Rassismus wird auch Kolonialrassismus genannt, da er auf den Versklavungshandel zurückgeht. Plünderung, Ausbeutung, Unterdrückung, Entmenschlichung und Gewalt erfuhren Legitimation, indem durch das Konstrukt der Rassifizierung weiße Menschen als höherwertig und überlegen, Schwarze dagegen als minderwertig und unterlegen kategorisiert wurden.
Diese kolonialen Denkmuster wirken bis heute fort. So werden Schwarze Menschen u.a. infantilisiert, exotisiert, sexualisiert und kriminalisiert. Durch Ausgrenzungen, Herabwürdigungen und Übergriffe werden sie zu „den Anderen“ (Othering) gemacht und suggeriert, dass sie nicht dazu gehören. Anti-Schwarzer Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches und strukturelles Problem, das innerhalb der weißen Mehrheit zu wenig Beachtung findet.
© Mirjam Silber 2023
Quellen/Literaturempfehlungen
Abdel-Samad, Hamed (2021). Schlacht der Identitäten. 20 Thesen zum Rassismus – und wie wir ihm die Macht nehmen. München. dtv.
Arndt, Susan (Hg., 2001). AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster. Unrast.
Arndt, Susan (2021). Rassismus begreifen. Vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen. München. C.H. Beck.
Arndt, Susan; Hornscheidt, Antje (Hg., 20183). Afrika und die deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster. Unrast.
Arndt, Susan; Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg., 20193). Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster. Unrast.
Aikins, Muna AnNisa; Bremberger, Teresa; Aikins, Joshua Kwesi; Gyamerah, Daniel; Yıldırım-Caliman, Deniz (2021). Afrozensus 2020: Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland. Berlin. Online verfügbar unter: https://afrozensus.de/ (letzter Zugriff: 27.04.2023).
Ayim, May; Oguntoye, Katharina; Schultz, Dagmar (Hg., 20202). Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Berlin. Orlanda.
DiAngelo, Robin (2020). Wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein. Hamburg. Hoffmann und Campe.
Eggers, Maureen Maisha; Kilomba, Grada; Piesche, Peggy; Arndt, Susan (Hg., 20173). Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster. Unrast.
Hasters, Alice (20212). Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. München. hanserblau.
Kelly, Natasha A. (2021). Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen! Zürich. Atrium.
Ogette, Tupoka (202110). exit RACISM. rassismuskritisch denken lernen. Münster. Unrast.
Ogette, Tupoka (2022). UND JETZT DU. Rassismuskritisch leben. München. Penguin.
Schwarz, Jordan (2020). Reflexion über Anti-Schwarzen Rassismus in Deutschland und Perspektiven für eine rassismuskritische Soziale Arbeit in Deutschland. Bachelorthesis. Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Online verfügbar unter: https://www.socialnet.de/materialien/29064.php (letzter Zugriff: 27.04.2023).
Sow, Noah (2018). Deutschland Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassismus. BoD (Books on Demand).
Antimuslimischer Rassismus bezeichnet die Ablehnung und Diskriminierung von Muslim:innen. Auch Personen, die als muslimisch gelesen werden, obwohl sie es nicht sind, können betroffen sein. Islamophobie oder Muslimfeindlichkeit sind ähnliche Begriffe.
Dabei konstruieren Angehörige der Mehrheitsgesellschaft eine Gruppe von „Anderen“ – die der Muslim:innen – als fremd. Oft wird dabei die muslimische Identität mit einer ethnischen Herkunft vermischt. Muslim:innen werden als minderwertig betrachtet und ihnen werden negative Eigenschaften zugeschrieben, wodurch ein Ungleichheitsverhältnis geschaffen wird.
Antimuslimischer Rassismus umfasst nicht nur die individuelle Ebene von Diskriminierung, sondern auch die strukturelle (z.B. Gesetze) und institutionelle (z.B. Behörden, Schulen). Zudem spielen die öffentliche Meinung über Muslim:innen und ihre Darstellung in den Medien eine zentrale Rolle.
Da der Völkermord der Nationalsozialist:innen an Sinti und Roma zunächst nicht anerkannt wurde, erhielten Überlebende keine Unterstützung. Die Verbrechen an ihnen blieben ungestraft. Diese Erfahrung und die anhaltende Diskriminierung nach 1945 begründeten die Bürgerrechtsbewegung deutscher Sint:izze und Rom:nja.
Anstoß der Bewegung war der Tod des Heidelberger Sinto Anton Lehmann durch Polizeischüsse im Juni 1973. Danach mehrten sich Aktionen gegen die fortgesetzte polizeiliche Sondererfassung, für die Herausgabe von NS-Akten und die Aufarbeitung der Verbrechen. Große Aufmerksamkeit erregte ein Hungerstreik auf dem Gelände des ehemaligen KZ Dachau an Ostern 1980, an dem sich auch Überlebende des Völkermords beteiligten. Sie forderten vor allem die Anerkennung des Völkermords an Sinti und Roma und die Bestrafung der Täter:innen. Erst 1982 erkannte die Bundesregierung gegenüber dem neu gegründeten Zentralrat Deutscher Sinti und Roma den rassistisch motivierten Völkermord an.
Quellenangabe / Literaturhinweis:
Gress, Daniela: Protest und Erinnerung. Der Hungerstreik in Dachau 1980 und die Entstehung der Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma, in: Karola Fings/Sybille Steinbacher (Hg.): Sinti und Roma. Der nationalsozialistische Völkermord in historischer und gesellschaftspolitischer Perspektive (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte), Göttingen 2021, S. 190-219.
Demokratie bedeutet „Herrschaft des Volkes“. In einer Demokratie liegen die Macht und die Entscheidungsfindung bei den Bürger:innen.
Sie haben das Recht und die Möglichkeit, ihre Meinung frei auszudrücken, politische Entscheidungen zu treffen und ihre politischen Vertreter:innen durch allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen zu bestimmen. Daneben zeichnet sich eine Demokratie durch Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Schutz der Menschenrechte aus. Die Idee der Demokratie gab es schon im 6. Jahrhundert in Griechenland. Die moderne Form hat sich daraus entwickelt. Sie unterscheidet sich sehr von jener frühen Volksherrschaft.
Die Ausgestaltung der konkreten Demokratie hängt unter anderem mit dem Grad der Bürger:innenbeteiligung zusammen. Die Grundformen reichen von repräsentativen Demokratien über deliberative Demokratien bis hin zu partizipatorischen Demokratien.
In Deutschland gibt es seit 1949 eine Demokratie, davor von 1918 bis 1933.
Diversität bedeutet „Vielfalt“. Der Begriff bezeichnet diverse Unterschiede zwischen Menschen innerhalb von Gruppen, Organisationen, Gemeinschaften oder Gesellschaften sowie die Anerkennung, Wertschätzung und Integration dieser Vielfalt.
Diese Unterschiede können beispielsweise auf kulturellen Hintergründen, Traditionen, Werten, Sprachen und religiösen Überzeugungen beruhen oder auf den Unterschieden zwischen Männern, Frauen, nicht-binären und geschlechtlich vielfältigen Personen. Aber auch unterschiedliche Altersgruppen, verschiedene sexuelle Orientierungen oder sozioökonomische Unterschiede können betrachtet werden, um von Diversität zu sprechen. Diversität ist eine wertvolle Ressource, da sie verschiedene Perspektiven, Erfahrungen, Fähigkeiten und Ideen in die Gesellschaft einbringt. Damit fördert sie Inklusion, Toleranz und den Respekt für Menschen unabhängig von ihren Unterschieden.
Der Begriff Empowerment kommt aus dem Englischen und bedeutet Ermächtigung. Er zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, mit den eigenen Ressourcen ihre soziale Lebenswelt selbst zu gestalten.
Mit Empowerment werden Strategien und Maßnahmen bezeichnet, die vorhandene Stärken und Ressourcen von Menschen herausstellen und fördern. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung von Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Interessen sollen (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten werden. Das Konzept entstammt der US-amerikanischen Gemeindepsychologie und beeinflusst heute viele Bereiche der Sozialen Arbeit und Bildung, der Gesundheitsförderung und der Entwicklungszusammenarbeit.
Entnazifizierung bezeichnet eine nach dem Zweiten Weltkrieg von den alliierten Siegermächten verfolgte Praxis, mit der Deutschland und Österreich von nationalsozialistischen Einflüssen befreit werden sollten.
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) und weitere NS-Organisationen wurden aufgelöst. Personen mit nationalsozialistischer Vergangenheit sollten aus Positionen in Politik, Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur entfernt und möglichst durch NS-Gegner:innen ersetzt werden. Kriegsverbrechen sollten verfolgt und bestraft werden; bedeutend waren v.a. die „Nürnberger Prozesse“.
Die Beschlüsse der Alliierten zur Entnazifizierung waren jedoch nicht genau ausgestaltet. So besetzten viele alte Nationalsozialist:innen in der Bundesrepublik schnell wieder wichtige Ämter. Die Verfolgung der Verbrechen blieb auf einen winzigen Kreis von Täter:innen beschränkt. Seit den späten 1960er-Jahren wurden diese Missstände in Deutschland zunehmend diskutiert.
Quellenangabe/Literaturhinweis:
Schneider, Gerd / Christiane Toyka-Seid: Das junge Politik-Lexikon von www.hanisauland.de, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2023.
Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg beschloss der deutsche Staat auf internationalen Druck hin Entschädigungen für Betroffene nationalsozialistischer Verfolgung und ihre Familien. Die Entschädigungen sollten als Schadensersatz für Gewalt, Verfolgung und Gefangenschaft gezahlt werden. Doch bei vielen Verfolgten kamen diese Zahlungen nie an.
Gesetzliche Grundlage war das Bundesentschädigungsgesetz, das 1953 in Kraft trat. Zuerst durften nur Menschen, die als „deutsche Juden:Jüdinnen” verfolgt wurden, Anträge stellen. Andere Opfergruppen wie Sinti:zze und Rom:nja oder Menschen mit Behinderung wurden auf Druck von Betroffenenorganisationen erst ab den 1980er Jahren schrittweise anerkannt und teilweise entschädigt. Viele Betroffene waren zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Bis heute müssen Entschädigungen in komplizierten Formularen beantragt werden. Entschädigungen für NS-Verfolgte haben nie mehr als 1% des Bruttosozialprodukts der Bundesrepublik ausgemacht.
Literatur:
Goschler, Constantin/ Herbst, Ludolf (Hg.) et.al. (2019): Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland (= Schriftenreihe der Vierteljahreshefte Für Zeitgeschichte, Sondernummer), Berlin/München/Bosten: De Gruyter.
Hayes, Peter (2017): Warum? Eine Geschichte des Holocaust, Frankfurt/Main: Campus Verlag.
Erinnerung lässt sich beschreiben als Umgang einer Person oder Gruppe mit der Vergangenheit, bei der diese vor dem Vergessen bewahrt wird. Die verschiedenen Umgangsformen einer Gesellschaft mit ihrer Geschichte, ihr Zusammenspiel und ihre Widersprüche, werden Erinnerungskultur genannt.
Ob auf Personen, Orte oder Ereignisse: Erinnerung kann sich auf alles richten, was in der Vergangenheit liegt. Genauso vielseitig wie das Erinnerte sind auch die verschiedenen Formen des Erinnerns. Obwohl die Erinnerung an den Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur inzwischen sehr zentral ist, musste sie über Jahrzehnte erkämpft und noch immer gegen starke Widerstände aufrechterhalten werden. Erinnerung ist also weder sicher noch konfliktfrei. Auch die Toleranzräume erinnern an Personen und Ereignisse aus der Geschichte und sind damit ein Teil der deutschen Erinnerungskultur.
Quellenangaben/Literaturhinweise:
Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Bonn 2007 (Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftenreihe 633).
Assmann, Aleida: Das gespaltene Gedächtnis Europas und das Konzept des dialogischen Erinnerns. In: Bernd Rill (Hg.): Nationales Gedächtnis in Deutschland und Polen. München 2011 (Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 73), S. 17–25.
Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999.
Csáky, Moritz/ Stachel, Peter (Hg.): Mehrdeutigkeit. Die Ambivalenz von Gedächtnis und Erinnerung. Wien 2003.
Csáky, Moritz (2004): Die Mehrdeutigkeit von Gedächtnis und Erinnerung. Ein kritischer Beitrag zur historischen Gedächtnisforschung. In: Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas 9/2004, online: http://epub.ub.uni-muenchen.de/603/1/csaky-gedaechtnis.pdf.
Halbwachs, Maurice: Les cadres sociaux de la mémoire. Paris 1925 (Travaux de l’Année sociologique) [dt. Berlin 1966], Französische Fassung online unter: https://doi.org/10.1515/9783110869439.
Wünsch, Thomas: Erinnerungskultur. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2013. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32831 (Stand: 07.03.2013).
Erinnerungsabwehr bezeichnet die Ablehnung, sich mit der persönlichen, schuldbelasteten Vergangenheit auseinanderzusetzen.
In Deutschland und Österreich versteht man unter Erinnerungs- oder Schuldabwehr insbesondere die Verweigerung, sich mit der (eigenen oder familiären) NS-Vergangenheit zu befassen. Innerer Beweggrund ist dabei laut der Psychologin Birgit Rommelspacher der Wunsch, „die Verbrechen des Nationalsozialismus zu vergessen und sich (…) der damit verbundenen Gefühle zu entledigen.“
Alle, die sich dennoch für ein Erinnern einsetzen, werden als lästig erlebt, weil sie dem eigenen Wunsch nach einem „Schlussstrich“ entgegenstehen. Die mit Scham verbundenen negativen Gefühle werden meist (aber nicht nur) auf Juden:Jüdinnen als vermeintliche Verursacher:innen dieser Emotionen übertragen. Diesen von Abwehr geleiteten (schuldprojektiven) Hass auf Juden:Jüdinnen nennt man Sekundären Antisemitismus oder Antisemitismus nach Auschwitz.
Literatur:
Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus: Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit, S. 15.
Mendel, Meron: Herausforderungen antisemitismuskritischer Bildungsarbeit, in: APuZ 70 (26-27/2020), S. 36-41.
Extremist:innen lehnen die Grundprinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung ab und bekämpfen sie aktiv. Diese Grundprinzipien sind z.B. die Achtung der Menschenrechte, Volkssouveränität, Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Gerichte.
Extremistische Bestrebungen zielen darauf ab, ein antidemokratisches politisches System zu errichten. Sie sind daher verfassungsfeindlich und können zu Verboten von Parteien oder Gruppen führen. Manche extremistischen Gruppierungen befürworten auch Gewalt als Mittel, um ihre Ziele zu erreichen.
Extremist:innen können Anhänger:innen unterschiedlicher Ideologien sein, z.B. Politischer Extremismus, religiös begründeter Extremismus oder Auslandsbezogener Extremismus. In Deutschland ist der Rechtsextremismus am weitesten verbreitet und stellt damit die größte Gefahr für die Demokratie dar.[1]
[1] Verfassungsschutzbericht 2022 – Bundesministerium des Innern und für Heimat
Verlassen Menschen ihre Heimatorte oder Heimatländer unfreiwillig, weil sie dort nicht sicher oder nur unter sehr schwierigen Umständen leben können, sprechen wir von Flucht. Fluchtgründe sind z.B. Gefahren, Konflikte, Krieg, politische, religiöse, ethnische oder geschlechtsspezifische Diskriminierung und Verfolgung, direkte Gewalt, Armut oder Naturkatastrophen.
Die Flucht von Menschen kann innerhalb eines Landes (Binnenflucht) oder über internationale Grenzen hinweg (internationale Flucht) erfolgen. Internationale Geflüchtete haben oft das Ziel, in einem anderen Land Asyl zu suchen und Schutz gemäß internationalen Flüchtlingsgesetzen zu erhalten. Internationale Organisationen wie das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) arbeiten daran, Geflüchteten humanitäre Hilfe, Schutz und Unterstützung zu bieten und Lösungen für ihre Situation zu finden.
Der Begriff „Gastarbeiter:innen“ bezieht sich auf Menschen, die als Arbeitskräfte vorübergehend in ein anderes Land ziehen, um dort zu arbeiten. Ziel ist es, den Lebensunterhalt zu sichern bzw. Geld zu verdienen, um die Familie im Herkunftsland zu unterstützen.
Diese Arbeiter:innen haben nicht die Absicht, dauerhaft in einem anderen Land zu bleiben. Sie werden oft von Regierungen eingeladen, um Arbeitskräfteengpässe in bestimmten Sektoren oder Regionen zu decken.
Heute wird der Begriff „Gastarbeiter:innen“ als veraltet und abwertend angesehen, da er den Eindruck erweckt, dass die Arbeitsmigrant:innen nur vorübergehend und nicht vollständig in die Gesellschaft des Landes integriert sind, in dem sie arbeiten. Stattdessen bevorzugen viele Menschen den Begriff „Arbeitsmigrant:in“, der die Vielfalt und den langfristigen Beitrag dieser Menschen in der Gesellschaft betont.
Unter Hasskriminalität werden Straftaten erfasst, die durch Vorurteile motiviert sind. Dazu gehört sowohl körperliche und psychische Gewalt wie auch Vandalismus gegen Orte, die für die betroffenen Gruppen sehr wichtig sind.
Der Begriff Hasskriminalität entstand in den USA. Dort erreichten in den 1980er Jahren Aktivist:innen, dass Straftaten gegen historisch diskriminierte Gruppen schärfer verurteilt werden. In Deutschland wurde 2015 beschlossen, die Perspektive der Betroffenen stärker zu berücksichtigen und höhere Strafen zu verhängen, wenn menschenverachtende Beweggründe nachgewiesen werden können. Im Jahr 2021 wurde das Gesetz erweitert, unter anderem um Bedrohungen im Internet. Hasskriminalität sendet immer auch eine Botschaft an die Betroffenen, an Gruppen, denen sie vermeintlich angehören, und die Gesellschaft als Ganze. Es geht den Täter:innen darum, Angst zu verbreiten und gesellschaftliche Gruppen auszugrenzen.
Heteronormativität ist der Glaube, dass Heterosexualität (Sexualität zwischen Männern und Frauen) die einzige normale und natürliche Form der sexuellen Orientierung ist. Dazu gehört die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt (männlich und weiblich) und Menschen dementsprechend erzogen werden sollten.
Heteronormativität ist oft unsichtbar, weil sie tief in unserer Kultur verankert ist. Sie prägt, wie wir über Liebe, Ehe und Familie sprechen.
Oft ist uns nicht bewusst, dass wir andere durch eine ‚heteronormative Brille‘ sehen. Durch diese Brille erscheinen alle Menschen heterosexuell und lieben eine Person des anderen Geschlechts. Menschen, die nicht heterosexuell sind, werden in einer heteronormativen Kultur als „anders“, oder gar als nicht „normal“ gesehen. Im extremen Fall führt diese Vorstellung zu Gewalt und Diskriminierung gegenüber nicht heterosexuellen Menschen. Dabei haben alle Menschen das Recht, zu lieben wen sie möchten und eine Familie zu gründen.
Der Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus wird als Holocaust (aus dem Griechischen, ‘Brandopfer’) oder Schoah bezeichnet. Schoah ist hebräisch und bedeutet „Unheil“ und „große Katastrophe“.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialist:innen 1933 begann die Demütigung, Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und in allen von Deutschen besetzten europäischen Ländern. Juden:Jüdinnen wurden zunehmend durch Gesetze und Verordnungen ausgeschlossen. Es folgten die Einweisung in örtliche Konzentrationslager und schließlich die Deportation in die deutschen Vernichtungslager in Polen. Ab Sommer 1941 begannen die Massenerschießungen von Jüdinnen:Juden. Der industriell organisierte Massenmord erfolgte dann in den Gaskammern der Vernichtungslager Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec und Chelmno. Mindestens sechs Millionen Juden:Jüdinnen wurden in dieser Zeit ermordet.
Literatur:
Wolfgang Benz (Hrsg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1996
Michael Wildt, Massenmord und Holocaust, Informationen zur politischen Bildung, online https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/nationalsozialismus-krieg-und-holocaust-316/151942/massenmord-und-holocaust/
Als Holocaust-Leugnung werden Aussagen bezeichnet, die behaupten, dass der Holocaust/ die Schoah nicht stattgefunden habe oder zumindest völlig übertrieben sei.
Diejenigen, die den Holocaust leugnen und ihn als „jüdische Propaganda“ bezeichnen, versuchen die Tatsache des Mords an Jüdinnen und Juden mit angeblich wissenschaftlichen Beweisen zu widerlegen.
Da der Holocaust aber eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache ist, werden Dokumente erfunden oder aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen als Beweise angeführt. Dies geschieht mit plumpen Methoden, falschen Zahlen und gefakten Gutachten. Der Holocaust wird auch geleugnet, wenn behauptet wird, es seien „nur“ wenige Menschen ermordet worden oder es habe keine Massenerschießungen von Juden:Jüdinnen oder keine Gaskammern gegeben. Die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland seit 1985 strafbar.
Literatur:
Brigitte Bailer-Galanda/Wolfgang Benz/ Wolfgang Neugebauer, Die Auschwitzleugner. „Revisionistische“ Geschichtslüge und historische Wahrheit, Berlin 1996
Deborah E. Lipstadt: Betrifft: Leugnen des Holocaust, Zürich 1998
Wolfgang Benz (Hrsg.), Legenden. Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, München 1992
Juliane Wetzel, Die Auschwitzlüge, in: Wolfgang Benz/Peter Reif-Spirek (Hrsg.), Geschichtsmythen. Legenden über den Nationalsozialismus, Berlin 2003, S. 27-41.
Unter einer Verzerrung des Holocaust werden Äußerungen verstanden, die die bekannten historischen Fakten entschuldigen, verharmlosen oder falsch darstellen.
Die Verzerrung leugnet zwar nicht die Fakten des Holocaust an sich, entschuldigt oder minimiert jedoch die Zahl der Opfer, stellt Fakten falsch dar oder relativiert seine Bedeutung. Dies erfolgt heute vor allem in den Sozialen Medien und ist im Unterschied zur Holocaust-Leugnung schwerer zu erkennen. Während der Corona-Pandemie verglichen sich Demonstrant:innen mit den jüdischen Opfern des Holocaust. In anderen Fällen wird der Begriff Holocaust verwendet, um öffentlich drastisch auf bestimmte gesellschaftliche Fragen hinzuweisen, wie etwa „Klima-Holocaust“, „Abtreibungsholocaust“ oder „Bomben-Holocaust“. Jede Verzerrung, ob absichtlich oder unabsichtlich, nährt Antisemitismus und kann zu Gewalt gegenüber Juden und Jüdinnen führen.
Literatur:
International Holocaust Remembrance Alliance, Holocaustverfälschung und -verharmlosung erkennen und bekämpfen, https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/reports/recognizing-countering-holocaust-distortion-recommendations
https://www.againstholocaustdistortion.org/
OSZE, Umgang mit Leugnung, Verzerrung und Verharmlosung des Holocaust, https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/475304.pdf
Umgang mit Holocaust-Verzerrung in den Sozialen Medien. Leitlinien und Empfehlungen für Gedenkstätten und Museen, https://holocaust-socialmedia.eu/wp-content/uploads/Umgang-mit-Holocaust-Verzerrungen-in-den-Sozialen-Medien.pdf
Homosexualität bezeichnet romantische und sexuelle Anziehung oder sexuelles Verhalten zwischen Menschen des gleichen Geschlechts. Sie ist eine natürliche und normale Variante der menschlichen Sexualität. Es gibt sie in allen Kulturen und sie ist in der Geschichte vielfältig dokumentiert.
Homosexuelle Menschen können sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder queer bezeichnen. Die Begriffe ändern sich im Laufe der Zeit. Wie bei allen Fragen von Liebe und Sexualität gibt es auch bei homosexuellen Menschen viele Formen, diese auszudrücken und zu leben.
Homosexuelle Beziehungen und Handlungen wurden im Laufe der Geschichte je nach Kultur akzeptiert, verleugnet oder verurteilt. Heute wissen wir, dass es nicht nur einen Grund gibt, warum jemand homo-, hetero- oder bisexuell ist.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eine weltweite Bewegung für die rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz homosexueller Menschen.
Der Begriff „Ideologie“ bezeichnet ein System von Ideen, Überzeugungen, Werten und Weltanschauungen, die in der Regel von einer bestimmten sozialen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Gruppe geteilt werden.
Ideologien sind Leitbilder, die dazu dienen, die Welt zu interpretieren, politische Entscheidungen zu treffen, soziale Beziehungen zu gestalten und individuelles Verhalten zu beeinflussen. Sie können Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gemeinschaft stärken und zur Entwicklung von geteilten Werten und daraus abgeleiteten Normen beitragen. Ideologien geben aber auch vor, dass sie die einzige richtige Lösung für gesellschaftliche Probleme haben. Sie können zu Konflikten führen, wenn sie mit anderen Ideologien unvereinbar sind oder zur Rechtfertigung von Unterdrückung, Diskriminierung oder Gewalt missbraucht werden.
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und an der Gesellschaft teilhaben können. Menschen mit Behinderungen haben also die gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderung.
Sie können z.B. selbst entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten. Außerdem haben sie das Recht auf ein inklusives Bildungssystem und auf die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt zu verdienen. Öffentliche Einrichtungen müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein und ihre Bedürfnisse berücksichtigen.
Seit 2009 ist Deutschland durch die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen diese Inklusion in und Partizipation an der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Isolation und Segregation, wie das Leben in Heimen, das Arbeiten in Sonderwelten oder das Lernen an besonderen Schulen sollen vermieden werden.
Der Islamische Staat (IS) ist eine terroristische islamistische Organisation, die ihre eigene Auslegung des Islams durchsetzen möchte.
Nachdem der IS große Gebiete im Irak und in Syrien erobert hatte, rief er 2014 in dieser Region das „Kalifat” aus und ging dort brutal gegen Nicht-Muslim:innen, Andersdenkende und Muslim:innen mit anderer Islamauslegung vor. Viele Menschen wurden durch den IS misshandelt, versklavt, getötet oder vertrieben.
Der IS hat weltweit Anhänger:innen rekrutiert, u. a. in den Sozialen Medien. Sie haben zahlreiche Anschläge verübt, z.B. den Anschlag im November 2015 im Bataclan in Paris, bei dem über 130 Menschen starben.
Eine internationale Militärkoalition bekämpfte den IS, sodass dieser die meisten der von ihm eroberten Gebiete bis 2019 wieder verlor und Einfluss einbüßte. Er gilt weiterhin als Gefahr, da er nach wie vor Anhänger:innen hat.
Islamismus ist eine Sammelbezeichnung für eine religiös begründete Ideologie, die mit absolutem Wahrheits- und Herrschaftsanspruch vertreten wird, aber von dem Großteil der Muslim:innen abgelehnt wird.
Islamist:innen begründen diese politische Ideologie mit dem, was sie als den „wahren Islam” verstehen. Der Glaube soll nicht nur persönlich gelebt, sondern eine soziale und politische Ordnung auf Grundlage ihrer Koran-Interpretation eingeführt werden.
Ein Kerngedanke des Islamismus ist, dass Staatsgewalt ausschließlich von Gott (Allah) ausgehen kann. Islamist:innen lehnen Werte wie Toleranz gegenüber Andersdenkenden und die Menschenrechte oftmals ab.
Islamismus umfasst diverse Gruppierungen, deren Ziele und Strategien sich unterscheiden. Einige Gruppen, wie z.B. der „Islamische Staat“ (IS) greifen selbst zu terroristischen Methoden. Andere lehnen Gewalt ab und versuchen, ihre Ziele durch politische Beteiligung zu erreichen.
In Deutschland leben ca. 225.000 Juden:Jüdinnen mit vielfältigen Lebensentwürfen und Identitäten. Doch die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft nimmt jüdisches Leben oft nicht oder nur verzerrt wahr.
Juden:Jüdinnen leben seit über 1.700 Jahren im heutigen Deutschland und prägen seitdem das gesellschaftliche Leben. Nach dem Bruch durch die Schoah (systematische Ermordung von Juden:Jüdinnen durch die Nationalsozialisten) hat sich allmählich – auch dank der Einwanderung vieler jüdischer Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion – wieder eine lebhafte, diverse jüdische Kultur aufgebaut: Zeitungen, Vereine, Synagogen, koschere Restaurants, Schulen und Krankenhäuser. In der Öffentlichkeit wird davon nur wenig wahrgenommen: Wenn über Juden:Jüdinnen berichtet wird, geht es meist um die Schoah, Antisemitismus oder den Nahostkonflikt. Zudem wird das Judentum oft mit jüdischer Religion gleichgesetzt, obwohl viele Juden:Jüdinnen nicht religiös leben und es eine ausgeprägte nichtreligiöse jüdische Kultur gibt.
Literatur:
Anne Frank Zentrum (2020): 7 Wege. Jüdische Biografien in Hamburg.
Bodemann, Y. Michal/ Geis, Jael: Gedächtnistheater. Die Jüdische Gemeinschaft und ihre deutsche Erfindung, Hamburg 1996.
Brenner, Michael (Hg.): Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart,
München 2012.
Cazés, Laura (Hrsg.) (2022): S/cher sind wir nicht geblieben. Jüdischsein in Deutschland, Frankfurt/Main: Fischer Verlag GmbH.
Coffey, Judith/ Lauman, Vivien (2021): Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen, Berlin: Verbrecher Verlag.
Wohl von Haselberg, Lea: Jüdische Sichtbarkeit und Diversität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 2020, Nr.26/27, S.8-13.
Zur Frage gendersensibler Bezeichnung von Juden:Jüdinnen, siehe Latkes Berlin (2020): Juden Gendern, online abrufbar unter »https://latkesberlin.wordpress.com/2020/10/24/juden-gendern/«
Das Kalifat ist eine religiös-politische Form der Führung der weltweiten Gemeinschaft der Muslim:innen. Der Kalif wird als Nachfolger des Propheten Mohammed betrachtet und ist an islamische Gesetze und Prinzipien gebunden.
Das erste Kalifat entstand nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632. In den folgenden Jahrhunderten gab es verschiedene Kalifate, die ihren Einfluss auf diverse Weltregionen ausdehnten. Der Kalif hatte daher eine bedeutende Rolle. Im Laufe der Zeit verlor er jedoch zunehmend an Einfluss. 1924 wurde der letzte Kalif abgesetzt.
Heute gibt es kein offizielles Kalifat mehr, es existiert nur noch als symbolische Vorstellung einer islamischen politischen Gemeinschaft. Verschiedene Gruppen verfolgen allerdings das Ziel, das Kalifat wieder zu errichten. Einige davon (z.B. der sogenannte „Islamische Staat“) werden als extremistisch betrachtet und sind in vielen Ländern verboten.
Kolonialismus bezeichnet eine Form der gewaltsamen Fremdherrschaft, die europäische Staaten bis ins 20. Jahrhundert über weite Teile der Welt ausübten.
Kolonien entstanden durch gewaltsame Invasion und Siedlungsgründung. Durch die Besiedelung und anschließende Ausbeutung der Kolonien weiteten europäische Staaten und Handelskompanien seit dem 15. Jahrhundert weltweit ihre politische, militärische, ökonomische und kulturelle Macht aus. Die Beziehung zwischen kolonialer Metropole (z.B. London, Berlin) und Kolonie (z.B. Indien, Togo) war hierarchisch und gewaltsam und wurde durch Ideologien wie christliche Mission, „Zivilisierung“ und Rassismus geprägt und zeitweise legitimiert. Fälle kolonialer Gewalt bezeichnet man heute als Genozide. Kolonialismus ist zudem mit der Versklavung von Millionen Menschen verbunden. Mit der Dekolonisation und Gründung unabhängiger Nationalstaaten ist Kolonialismus Geschichte. Prägend ist er jedoch bis heute – politisch, militärisch, ökonomisch und kulturell.
Quellenangaben / Literaturhinweise:
Eckert, Andreas: Kolonialismus. S. Fischer 2015.
Grewe, Bernd-Stefan & Thomas Lange: Kolonialismus. Reclam 2025.
Habermas, Rebekka: Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft, S. Fischer 2016.
Jansen, Jan C. & Jürgen Osterhammel: Dekolonisation. Das Ende der Imperien, C.H.Beck 2013.
Osterhammel, Jürgen & Jan C. Jansen: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen. C.H.Beck 2021.
Neuzeit kann man m.E. an dieser Stelle weglassen, da unten der Start der Kolonialzeit (15. Jh.) genannt wird [ul1]
LGBTIQA+ ist eine Abkürzung, die möglichst viele Menschen unterschiedlicher Sexualität und Geschlechtsidentität sichtbar machen soll. Häufig werden diese Menschen diskriminiert.
Früher wurde oft nur über Lesben (L) und Schwule bzw. Gays (G), also gleichgeschlechtlich begehrende Männer und Frauen, gesprochen. Betroffen sind aber auch: Bisexuelle Menschen (B) deren Begehren sich nicht auf ein Geschlecht begrenzt. Trans*Menschen (T) deren Geschlecht nicht dem entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Intergeschlechtliche Menschen (I) deren Körper nicht der medizinischen Norm von „eindeutig männlich oder „eindeutig weiblich“ entsprechen. Queere Menschen (Q) die ihre Sexualität in keine Schublade fassen wollen. Asexuelle Menschen (A) die kein oder kaum Verlangen nach sexueller Interaktion fühlen. Das „+“ deutet an, dass auch diese Bezeichnungen nicht ausreichen, um all jene zu beschreiben, die nicht als gesellschaftliche Norm wahrgenommen und ausgegrenzt werden.
Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, unabhängig von der Regierung, politischen Ansichten oder gesellschaftlichen Normen.
Meinungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht und im Grundgesetz sowie der Menschenrechtserklärung der UNO festgelegt. Sie ist entscheidend für eine offene, pluralistische und demokratische Gesellschaft. Denn Meinungsfreiheit ermöglicht es Menschen, ihre Überzeugungen ohne Angst vor staatlicher Zensur und Bestrafung auszudrücken. Sie fördert den freien Austausch von Ideen, Wissen und Informationen und gibt den Menschen die Möglichkeit, politische Entscheidungen kritisch zu beurteilen. Das trägt zur Transparenz in der Politik bei. Es gibt jedoch auch Grenzen für die Meinungsfreiheit: Aufrufe zur Gewalt, Verleumdung, Verbreitung von Hassreden oder Volksverhetzung sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt und können in vielen Ländern bestraft werden.
In Deutschland versteht man unter einer Behinderung, wenn die Teilhabe von Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eingeschränkt ist.
Diese Einschränkungen liegen daran, dass die Menschen in ihrer Umwelt auf Hindernisse stoßen. Daher heißt es auch nicht, ein Mensch ist behindert, sondern er wird behindert.
Das deutsche Gesetz sagt: Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft wahrscheinlich länger als sechs Monate hindern können.
Außerdem muss die Beeinträchtigung für das Lebensalter unüblich sein. Ein hochaltriger, nicht mehr sehr beweglicher, Mensch ist z.B. nach dieser Definition kein Mensch mit Behinderung.
In Deutschland leben ca. 13 Mio. Menschen mit Behinderungen, das ist etwa ein Sechstel der Gesamtbevölkerung.
Migrationsgesellschaften sind Gesellschaften, die durch die Präsenz und kontinuierliche Einflüsse von menschlichen Wanderungssprozessen geprägt sind.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass es viel Einwanderung und Auswanderung gibt und sehr unterschiedliche Menschen dort leben. Das Zusammenleben von Menschen mit verschiedensten Hintergründen und Erfahrungen führt zu einer Bereicherung der Gesellschaft. Zugleich können soziale und politische Herausforderungen im Zusammenhang mit Integration, Inklusion und Identität entstehen.
Frühere Gesellschaften gingen davon aus, dass die meisten ihrer Bürger:innen dieselbe Herkunft und Kultur haben (Homogenität). Migration von Menschen wurde als Ausnahmeerscheinung betrachtet. Heute hingegen muss Migration als wichtiger Teil der Gesellschaft anerkannt werden. Dies betont zugleich die Notwendigkeit für inklusive und respektvolle Herangehensweisen im Umgang mit den Komplexitäten gesellschaftlicher Vielfalt.
Wenn eine Gruppe einen oder mehrere Menschen beleidigt, schikaniert oder ausgrenzt, dann sprechen wir von Mobbing bzw. davon, dass jemand „gemobbt“ wird.
Trotz fließendem Übergang muss zwischen Mobbing und Diskriminierung unterschieden werden. Bei beiden Fällen liegt zunächst eine Machtungleichheit vor. Mobbing geht meist von einer festen Gruppe aus und kann bereits durch persönliche Abneigung begründet sein. Diskriminierungen erfolgen dagegen auch außerhalb einer Gruppe oder Institution auf Grundlage kategorialer Zuordnung: Unterschiede bezüglich Herkunft, Klasse, Geschlecht, Religion, Sprache oder auch Behinderungen stellen ein erhöhtes Risiko dar, Abwertung und Benachteiligung zu erfahren. Das verbindende Merkmal beider Phänomene ist ein „Stärkeungleichgewicht“, welches Täter:innen ausnutzen. Nicht selten hat dieses Verhalten fatale psychische und soziale Folgen für Identität und Selbstwertgefühl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Neue Rechte ist eine Sammelbezeichnung, mit dem Ziel, sich von der „alten Rechten” abzugrenzen. Dabei sind Unterschiede zum klassischen Rechtsextremismus verschwindend gering.
Vertreter:innen der „neuen Rechten” berufen sich auf die „Konservative Revolution”, also auf rechtsnationale Intellektuelle aus der Zeit der Weimarer Republik, die als Vordenker:innen des Nationalsozialismus gelten. Sie wollen die Errungenschaften liberaler Gesellschaften abschaffen. Dabei machen sie sich genau diese zunutze, um Räume für sich zu beanspruchen. Sie brechen gezielt vermeintliche gesellschaftliche Tabus und nutzen so die Meinungsfreiheit, um Rassismus, LGBTQIA+-Feindlichkeit und Antisemitismus zu normalisieren. Dabei steht die „neue” ebenso wie die „alte” Rechte für Flüchtlingsfeindlichkeit, Antifeminismus, Islamfeindlichkeit, Homo- und Trans*-Feindlichkeit und ist in Teilen antisemitisch.
Rechte Strukturen sind bundesweit und international miteinander vernetzt und unterstützend tätig.
Rechtsextremismus wird oft pauschal als ostdeutsches Phänomen wahrgenommen. Der Fokus sollte aber auf bundesweiter Vernetzung im Engagement gegen Rechts liegen. Beispielsweise hat die rechte Initiative „Zusammenrücken Mitteldeutschland“ bei Leipzig, deren Leitfigur Christian Fischer aus Niedersachsen kommt, vor allem Westdeutsche als Zielgruppe, die hier das vermeintlich „ausländerfreie“ und konservative Idyll suchen. Ein weiteres Beispiel ist das „Hotel Neisseblick“ in Ostritz, an der Grenze zu Polen. Seit 1993 gehört es einem Ex-Mitglied der Republikaner und wird für NPD-Treffen sowie rechtsextreme Sport- und Familienfeiern genutzt, z.B. das „Schild- und Schwert-Festival“ im Jahr 2018. Auch das NSU-Terrornetzwerk mordete in beiden Teilen Deutschlands durch die Mithilfe lokaler Unterstützer:innen.
PoC ist eine Selbstbezeichnung für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Der Begriff wird im Deutschen auf Englisch verwendet, um (kolonial)rassistische Sprache zu vermeiden und sich gegen diskriminierende Fremdbenennungen durch eine weiße Mehrheitsgesellschaft zu positionieren.
Häufig werden die Begriffe Person bzw. People of Color und Black/Schwarze synonym benutzt. Tatsächlich meint PoC aber alle von Rassismus betroffenen Menschen mit afrikanischen, arabischen, jüdischen, asiatischen, lateinamerikanischen etc. Hintergründen.
Diese Vielfalt findet sich bspw. auch in der Selbstbenennung BIPoC (Black, Indigenous and Person/People of Color) wieder. Rassismuskritische Sprache ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, solidarische Bündnisse zwischen den durch die weiße Dominanzkultur marginalisierten Gruppen zu schließen, ihnen Selbstbestimmung sowie Gleichheit und Inklusion zu gewährleisten.
© Mirjam Silber 2023
Quellen/Literaturempfehlungen
Abdel-Samad, Hamed (2021). Schlacht der Identitäten. 20 Thesen zum Rassismus – und wie wir ihm die Macht nehmen. München. dtv.
Arndt, Susan (2021). Rassismus begreifen. Vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen. München. C.H. Beck.
Arndt, Susan; Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg., 20193). Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster. Unrast.
Ataman, Ferda (2019). Hört auf zu fragen. Ich bin von hier! Frankfurt am Main. Fischer.
DiAngelo, Robin (2020). Wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein. Hamburg. Hoffmann und Campe.
Eggers, Maureen Maisha; Kilomba, Grada; Piesche, Peggy; Arndt, Susan (Hg., 20173). Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster. Unrast.
Ha, Kien Nghi; Lauré al-Samarai, Nicola; Mysorekar, Sheila (Hg., 20162). re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Münster. Unrast.
Hasters, Alice (20212). Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. München. hanserblau.
Kelly, Natasha A. (2021). Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen! Zürich. Atrium.
Ogette, Tupoka (202110). exit RACISM. rassismuskritisch denken lernen. Münster. Unrast.
(2022). UND JETZT DU. Rassismuskritisch leben. München. Penguin.
Roig, Emilia (2021). Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung. Berlin. Aufbau.
Sow, Noah (2018). Deutschland Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassismus. BoD (Books on Demand).
Pogrome sind Gewalttaten, die von der Bevölkerung gegen eine bestimmte Minderheit ausgeübt werden. Oft werden Pogrome vom Staat geduldet oder unterstützt.
Bei den Pogromen am 9. November 1938 wurden nahezu überall im nationalsozialistischen Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte, Häuser und Friedhöfe zerstört und zehntausende Juden:Jüdinnen inhaftiert. Der Begriff „Pogrom” (russisch: Verwüstung) wurde Ende des 19. Jahrhunderts geprägt, als es in Russland zu antijüdischen Pogromen kam. Heute wird der Begriff allgemein für gewalttätige Ausschreitungen gegen religiöse, nationale oder ethnische Minderheiten verwendet. Diese Gewalt äußert sich durch Hetze, Plünderungen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder tödliche Angriffe. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist das rassistische Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992, bei dem eine Unterkunft für Asylsuchende angegriffen und in Brand gesetzt wurde.
Literatur:
Bergmann, Werner: Pogrome. In: Benz, Wolfgang (Hg.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Bd. 3: Begriffe, Theorien, Ideologien, Berlin/New York 2010, S. 269-270.
Von Populismus sprechen wir, wenn Einzelpersonen oder eine Gruppe versuchen, breite Unterstützung in der Gesellschaft zu gewinnen, indem sie sich als Vertreter:innen des „Volkes“ gegen vermeintliche Eliten positionieren.
Dabei wird die Legitimität bestehender politischer Institutionen und Systeme in Frage gestellt und der politischen Klasse vorgeworfen, nicht im Interesse des Volkes zu handeln. Populist:innen sprechen oft die Ängste, Sorgen und Frustrationen der Bevölkerung an und versprechen einfache unrealistische Lösungen für komplexe Probleme.
Einige sehen im Populismus eine notwendige Reaktion auf legitime Anliegen der Bevölkerung und eine Möglichkeit, Transparenz von politischen Eliten einzufordern. Jedoch kann Populismus demokratische Institutionen untergraben und Spaltungen in der Gesellschaft vertiefen. Er ist antipluralistisch und damit auch antidemokratisch.
Rechte Landnahme ist die strategische Raumnahme durch rechtsextreme Strukturen. Ziel ist es, bestehende Netzwerke zu unterwandern und eigene zu schaffen.
Für rechte Landnahme ist der ländliche Raum wegen seiner schwachen Infrastruktur, dem geringem Ausländer:innenanteil und günstigen Immobilienpreisen attraktiv. Die vorhandene Dorfgemeinschaft lebt oft traditioneller als Menschen in der Großstadt, engagierter Zuwachs ist willkommen. Dies erleichtert die Etablierung rechtsextremer Strukturen.
So werden ganze Ortschaften eingenommen, wenn Zivilgesellschaft und Politik untätig bleiben.
Das Erscheinungsbild von Neonazis hat sich gewandelt. Dies macht ein Erkennen schwer und sie werden in der Nachbarschaft als „ganz normale Leute“ wahrgenommen.
Ihre traditionellen Feste wirken harmlos, stellen sich aber oftmals als große Vernetzungstreffen heraus. Dort entstehen politische Verbindungen und Unterstützung wird ausgebaut.
Religiös begründeter Extremismus richtet sich gegen den demokratischen Verfassungsstaat und eine freie Gesellschaft. Anhänger:innen dieser Formen von Extremismus möchten ein politisches System installieren, das sich auf ihre spezifische Interpretation einer Religion beruft. Sie sind der Überzeugung, dass ihr religiöser Glaube der einzig wahre ist.
Dabei ist nicht die Religion an sich extremistisch, sondern wird für politische Zwecke instrumentalisiert. Der “Islamistische Fundamentalismus” ist ein Beispiel für religiös begründeten Extremismus. In diesem Fall wird der Islam instrumentalisiert.
Religiös begründeter Extremismus kann sich auf verschiedene Weisen zeigen, z.B. in der Diskriminierung von Andersgläubigen aber auch Terrorismus oder gewaltsame Übergriffe zählen dazu. Diese Form des Extremismus existiert weltweit und ist in fast allen großen Religionen vorzufinden.
Als Reparationen werden Wiedergutmachungsleistungen für Schäden bezeichnet, die durch Krieg erlitten wurden. Reparationen werden von den Verlierer:innen an die Sieger:innen eines Krieges gezahlt.
Reparationen können unterschiedlicher Art sein: Geldzahlungen oder Sachleistungen, die z.B. in Form von Warenlieferungen oder über den Abbau von Maschinen und Industrieanlagen (Demontagen) erfolgen.
In Deutschland wird der Begriff oft mit dem Ersten Weltkrieg verbunden, nach dessen Ende Deutschland im Versailler Vertrag (1919) die alleinige Kriegsschuld und die Zahlung von hohen Reparationen auferlegt wurden. Beides stieß in der deutschen Bevölkerung auf starke Ablehnung. Antidemokrat:innen machten sich diese Wut und die wirtschaftlichen Probleme vieler Menschen für ihren Kampf gegen die junge Demokratie der Weimarer Republik zunutze – nicht zuletzt, indem sie deutsche Juden:Jüdinnen und Sozialdemokrat:innen als vermeintliche Verräter:innen des deutschen Volkes darstellten.
Quellenangabe/Literaturhinweis:
Schneider, Gerd / Christiane Toyka-Seid: Das junge Politik-Lexikon von www.hanisauland.de, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2023.
Scharia ist ein arabischer Begriff, der u.a. „(von Gott) gebahnter Weg“ bedeutet. Die Scharia wird oft verkürzt als islamisches Recht bezeichnet. Sie ist kein Gesetzbuch, sondern kann als Gesamtheit der islamischen Normen verstanden werden. Ihre Hauptquellen sind der Koran und die Sunna (überlieferte Worte und Gewohnheiten des Propheten Mohammed).
Die Scharia umfasst religiöse Verpflichtungen (z.B. Gebetsrituale, Kleidungsvorschriften) und rechtliche Regelungen wie das Ehe- oder Familienrecht. Diese Vorschriften können jedoch strenger oder milder interpretiert werden. Sie unterscheiden sich je nach Region und Richtung des Islam und es gibt eine Vielfalt an Rechtsschulen. Die Scharia hat sich seit Gründung des Islams entwickelt und wandelt sich bis heute weiter.
In vielen islamisch geprägten Ländern gibt es sowohl Gesetze, die auf der Scharia basieren, als auch nicht-islamische Gesetze.
Staatsangehörigkeit bedeutet, dass eine Person zur politischen Gemeinschaft eines Staates gehört. Sie hat dadurch im jeweiligen Staatsgebiet bestimmte Rechte, wie das Recht auf Schutz durch den Staat, die Möglichkeit zur politischen Teilhabe sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte.
Gleichzeitig hat die Person auch Pflichten, die durch die Gesetze des Staates festgelegt sind, wie die Steuerpflicht oder die Einhaltung der nationalen Gesetze. Eine Staatsangehörigkeit kann auf verschiedene Weise erworben werden, beispielsweise durch Geburt, Eheschließung, Adoption oder Einbürgerung. In einigen Ländern kann die Staatsangehörigkeit beispielsweise bei schweren Verbrechen oder im Zusammenhang mit Terrorismus entzogen werden. Wenn eine Person die Staatsangehörigkeit mehrerer Staaten besitzt, spricht man von Doppelstaatsangehörigkeit oder Mehrstaatigkeit.
Die politische Selbstbezeichnung Sinti und Roma (auch Sinti:zze und Rom:nja) benennt die größte seit Jahrhunderten ansässige europäische Minderheit. Innerhalb der Minderheit gibt es eine große Vielfalt unterschiedlicher Gruppen und Kulturen.
In Deutschland sind Sinti und Roma seit über 600 Jahren beheimatet. Sie sind deutsche Staatsbürger:innen und seit 1995 eine anerkannte nationale Minderheit. Viele Sinti und Roma sind jedoch staatenlos, da ihnen während des Nationalsozialismus die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Außerdem leben auch zugewanderte Roma in Deutschland. „Die“ Sinti und Roma gibt es nicht. Die verschiedenen und vielfältigen Gruppen sind stark durch die Kulturen ihrer jeweiligen Heimatländer beeinflusst und haben diese auch selbst mitgeprägt. Eine Gemeinsamkeit vieler Sinti und Roma ist die Sprache “Romanes”.
Während des Nationalsozialismus wurden Sinti und Roma Opfer des Völkermordes. Bis heute sind sie von einem spezifischen Rassismus, dem Antiziganismus, betroffen.
Quellenangabe / Literaturhinweis:
Fings, Karola: Sinti und Roma. Geschichte einer Minderheit, München 2016.
Hier ist eine inhaltliche Lücke, die die Staatenlosigkeit vieler Sinti und Roma kurz und knapp benennt. [CJ1]
Der Sozialdarwinismus ist eine umstrittene Ideologie. Er wendet Darwins Theorie von der Evolution durch natürliche Auslese auf die menschliche Gesellschaft an.
Er besagt, dass Wettbewerb zwischen Einzelnen und Gruppen dazu führt, dass nur die Stärksten und Fähigsten erfolgreich sind und überleben. Deshalb sind Ungleichheit und soziale Hierarchien natürlich und wünschenswert, da sie den Fortschritt der Gesellschaft fördern. Die Ideologie des Sozialdarwinismus entwickelte sich im 19. Jh. aus der Evolutionstheorie von Darwin. Sie wurde oft als Rechtfertigung für soziale Ungleichheit sowie Ausbeutung und Diskriminierung von sozial Schwächeren verwendet und diente als Grundlage für imperialistische Ideologien, Rassentheorien und die Eugenik. Kritiker des Sozialdarwinismus bemängeln, dass er die Evolutionstheorie falsch anwendet, da er menschliches Verhalten auf biologische Prozesse reduziert. Außerdem widerspricht er dem Grundsatz, dass alle Menschen gleichwertig sind.
Teilhabe bezeichnet das Engagement von Menschen, um an der Gestaltung von Politik und Gesellschaft mitzuwirken.
Das kann z.B. bedeuten, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, die Stimme öffentlich zu erheben, die eigenen Rechte zu verteidigen oder Anliegen und Interessen zu vertreten. Teilhabe kann politisch sein, wie die Teilnahme an Wahlen oder Demonstrationen, Mitgliedschaft in einer Partei, Übernahme politischer Ämter oder politische Äußerungen durch Online-Postings. Eine andere Form der Teilhabe ist zivilgesellschaftliches Engagement, wie die Mitwirkung in NGOs, Bürgerinitiativen oder Interessengruppen.
Durch die Teilhabe der Bürger:innen können soziale Probleme angesprochen, innovative Lösungen entwickelt und positive Veränderungen in der Gesellschaft gefördert werden.Teilhabemöglichkeiten müssen dafür möglichst niedrigschwellig sein und Barrieren wie z.B. Zugangsbeschränkungen, Diskriminierung oder mangelnde politische Bildung abgebaut werden.
Transfeindlichkeit beschreibt diskriminierende Haltungen, Äußerungen, Übergriffe und Strukturen, die sich gegen Trans*Menschen richten. Damit sind Menschen gemeint, deren Geschlecht nicht dem entspricht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
In unserer Gesellschaft glauben viele Menschen, dass es nur zwei Geschlechter gäbe und diese eindeutig mit bestimmten biologischen Merkmalen (z.B. Genitalien oder Chromosomen) gleichgesetzt werden können. Dies trifft aber auf viele Menschen gar nicht zu, so z.B. bei Trans*Menschen. Sie begegnen daher immer wieder Vorurteilen und ihre Identität wird oft nicht ernst genommen oder sogar aberkannt. Trans*Personen werden aufgrund ihrer Geschlechtsidentität und auch Sexualität häufig nicht als gesellschaftliche Norm wahrgenommen, sind von Diskriminierung betroffen, erleben Übergriffe auf ihre Person bis hin zu Gewalt.
Als Verschwörungsideologien werden unumstößliche Weltbilder bezeichnet. Sie beruhen auf der Annahme, dass eine kleine Gruppe im Verborgenen geheime Absprachen trifft und die Geschicke der Welt lenkt.
Trotz inhaltlicher Unterschiede gibt es drei gemeinsame Merkmale: Alles sei von den Verschwörer:innen geplant. Alles sei Teil der Verschwörung. Alles hänge miteinander zusammen. Die Anhänger:innen erleben sich als „Wissende“ in einer blinden Umgebung. Anders als wissenschaftliche Erkenntnisse kann die Verschwörungsideologie nicht widerlegt werden. Jeder Gegenbeweis gilt als Teil der Verschwörung.
Da Juden:Jüdinnen in christlichen Gesellschaften seit der Spätantike unterstellt wird, böse Verschwörer:innen zu sein, haben viele Verschwörungserzählungen bis heute einen judenfeindlichen Kern. Der folgenreichste Mythos ist die gefälschte Propagandaschrift „Die Protokolle der Weisen von Zion“, die eine ideologische Grundlage für den Holocaust darstellte.
Literatur:
Die größte Gruppe von Einwander:innen in der DDR bestand aus Arbeitsmigrant:innen, die seit Beginn der 1960er Jahre nach Deutschland kamen. Offiziell wurden sie als „ausländische Werktätige“ bezeichnet und aus sozialistisch geprägten Ländern rekrutiert.
Zu Beginn kamen Arbeitsmigrant:innen aus direkten DDR-Nachbarländern. Mit steigendem wirtschaftlichem Bedarf wurden auch Menschen aus außereuropäischen Ländern angeworben. In den 1960ern wurden Verträge mit Polen und Ungarn geschlossen. Später unterzeichnete die DDR weitere Verträge mit Algerien (1974), Kuba (1975), Mosambik (1979), Vietnam (1980) und Angola (1984). In begrenztem Umfang entsandten auch die Mongolei (1982), China und Nordkorea (1986) Arbeitskräfte.
Verglichen mit der Gesamtbevölkerung war die Anzahl der ausländischen Arbeitsmigrant:innen in der DDR gering. 1989 waren es etwa 91.000 bis 94.000 „Vertragsarbeiter:innen.
Quellen:
Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2002, S. 304.
Sandra Gruner-Domić, Zur Geschichte der Arbeitskräftemigration in die DDR. Die bilateralen Verträge zur Beschäftigung ausländischer Arbeiter (1961–1989), in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 32 (Juni 1996) 2, S. 204–230, hier S. 206ff.
Völkermord bezeichnet die gewaltsame Ausgrenzung, gezielte Ermordung und Verfolgung von Gruppen, die sich durch Religion, Sprache und Tradition von anderen unterscheiden. Völkermord wird auch als Genozid bezeichnet.
Ein Völkermord beabsichtigt die systematische Auslöschung einer Gruppe aus nationalen, religiösen oder ethnischen Gründen. Den Begriff prägte der Jurist Raphael Lemkin, der als Jude vor den Nationalsozialist:innen in die USA geflohen war. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Sinti:zze und Rom:nja ebenso wie Juden:Jüdinnen in Deutschland stigmatisiert, systematisch verfolgt und ermordet. Auch die weitgehende Ermordung des Volkes der Herero von 1905 bis 1908 durch deutsche Kolonialtruppen im heutigen Namibia gilt als Völkermord. 1948 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“, die Völkermord international unter Strafe gestellt.
Quellenangabe
Boris Barth, Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. C.H.Beck 2006.
Wolfgang Benz, Der Holocaust, C.H.Beck 2018.
Matthias Häussler, Der Genozid an den Herero. Krieg, Emotion und extreme Gewalt in Deutsch-Südwestafrika, Vellbrück 2018.
Yves Ternon, Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert, Hamburger Edition 1996.
Gerhard Werle und Florian Jeßberger, Völkerstrafrecht, Mohr Siebeck 2020.
International Holocaust Remembrance Alliance: Holocaust und andere Völkermorde, online unter: https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/educational-materials/holocaust-und-andere-voelkermorde
Anne Frank Haus: Die Vereinten Nationen beschließen die Völkermord-Konvention, online unter: https://www.annefrank.org/de/timeline/123/die-vereinten-nationen-beschlieen-die-volkermord-konvention/
Genocide Alert: Der Völkermord an den Herero und Nama (1904-1908), online unter: https://www.genocide-alert.de/projekte/deutschland-und-massenverbrechen/herero-und-nama/
Migrations Geschichten(2022): Porajmos: Anfänge und Anerkennung eines Genozids, online unter: https://migrations-geschichten.de/porajmos-anfaenge-und-anerkennung-eines-genozids/
Im Völkermord an den Sinti und Roma fand der Antiziganismus während des Nationalsozialismus seinen negativen Höhepunkt. In manchen Gedenkkulturen wird auch von „Porajmos“ (Romanes für „das große Verschlingen“) gesprochen.
Dem Völkermord ging die Erfassung von Sinti und Roma (auch Sinti:zze und Rom:nja) durch die „Rassehygienische Forschungsstelle“ sowie die Kriminalpolizei anhand pseudowissenschaftlicher „Rassegutachten“ und die stufenweise Ausgrenzung und Entrechtung voraus. Ab Mai 1940 begann die systematische Ermordung von Hunderttausenden mit den ersten Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau. Unzählige Sinti und Roma wurden außerdem bei Massenerschießungen im besetzten Osteuropa ermordet. Die exakte Anzahl der Opfer ist bis heute nur schwer zu beziffern. Die Bundesregierung erkannte den Völkermord der Nationalsozialist:innen an den Sinti und Roma erst 1982 auf Bestreben der Bürgerrechtsbewegung an.
Quellenangabe / Literaturhinweis:
Rose, Romani (Hrsg.): „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“. Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, Heidelberg 1999.
Damit werden Familienstrukturen bezeichnet, die die völkisch-nationale Ideologie in all ihren Grundsätzen ausleben, erhalten und an die nächsten Generationen weitergeben möchten.
Menschen mit dieser Weltanschauung verstehen sich einer „Volksgemeinschaft“ zugehörig. Sie lehnen individuelle Lebensentwürfe und Erscheinungsformen der Moderne ab. Sie leben in klassischen Rollenbildern, abseits staatlicher Strukturen. Frauen unterstützen ihren Mann, gebären möglichst viele Kinder und sind für deren völkische Erziehung zuständig. Völkische Menschen engagieren sich ehrenamtlich in vorhandenen oder eigens gegründeten Strukturen. Ihre Ideologie wird meist erst sichtbar, wenn sie sich schon in die Gesellschaft integriert haben. Ihre Strategie zielt auf eine langfristige Wirkungsweise, die Vormachtstellung und den politischen Einfluss vor Ort ab.
Der NS-Staat stützte sich im Laufe des Krieges wesentlich auf die Ausbeutung von Zwangsarbeiter:innen. Über 20 Millionen Menschen wurden von den Nazis in Arbeitseinsätze gezwungen. 1944 war fast ein Drittel aller Arbeiter:innen des Deutschen Reichs zwangsbeschäftigt.
Die Arbeitskräfte waren Inhaftierte aus Konzentrationslagern, Kriegsgefangene oder »Zivilarbeitskräfte«, die aus dem Ausland verschleppt wurden, um die durch die Kriegsbestrebungen stark erhöhten Produktionsanforderungen des Deutschen Reichs zu decken.
Die Zwangsarbeiter:innen wurden meist in überfüllten Barracken untergebracht und tageweise an Betriebe und Einzelpersonen vermietet. Den Erlös bekam nur der NS-Staat ausgezahlt. Über eine halbe Million Menschen starb durch Zwangsarbeit.
Lange Zeit erfuhren die Opfer weder Würdigung noch Entschädigung. Auf internationalen Druck hin wurde 2000 die Stiftung »Erinnerung, Verantwortung, Zukunft« gegründet, die auch ehemalige Zwangsarbeiter:innen anerkannte.
Literatur:
Hayes, Peter (2017): Warum? Eine Geschichte des Holocaust, Frankfurt am Main: Campus Verlag, S. 184-200.
Knigge,Volkhard / Lüttgenau, Rikola-Gunnar / Wagner, Jens (Hrsg.) (2010): Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg, Weimar: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Spoerer, Mark (2001): Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945, Stuttgart/München: Deutsche Verlags-Anstalt (DVA).
Online-Archiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit, URL: »https://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/zeitzeugenarchiv«.
Stiftung EVZ / Freie Universität Berlin / Deutsches Historisches Museum (o.J.): Die Nationalsozialistische Zwangsarbeit – Hintergrundinformationen, in: Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte (Online-Archiv), URL: »https://www.zwangsarbeit-archiv.de/zwangsarbeit/zwangsarbeit/zwangsarbeit-hintergrund/index.html«